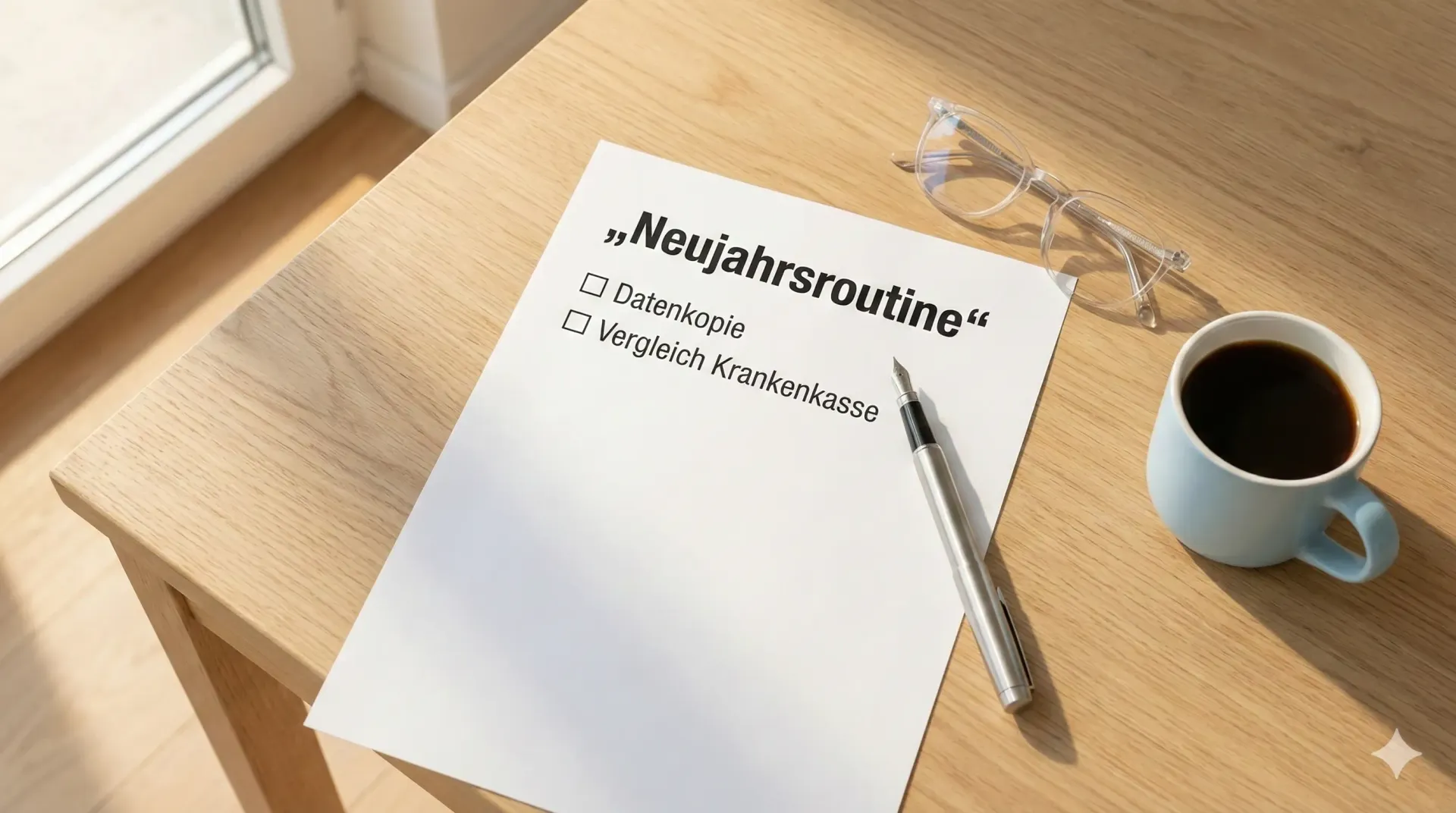von Mike Lehmann + AI
•
13. Dezember 2025
Das Jahr der Weichenstellung 2026 könnte sich als Wendepunkt erweisen – nicht durch spektakuläre Ereignisse, sondern durch das Zusammenwirken struktureller Veränderungen, die bereits im Gange sind. Künstliche Intelligenz verändert die Produktivitätslandschaft, geopolitische Spannungen könnten sich auflösen oder verschärfen, und die Volkswirtschaften kämpfen mit den Nachwehen mehrerer Krisenjahre. Für Anleger bedeutet das: Navigation wird wichtiger als bloße Marktpartizipation. Dieser Ausblick ordnet die wesentlichen Entwicklungen ein – von den makroökonomischen Fundamentaldaten über regionale Besonderheiten bis zu den Implikationen eines möglichen Ukraine-Friedens. Dabei geht es nicht um Gewissheiten, sondern um Wahrscheinlichkeiten und deren Konsequenzen für verschiedene Anlageklassen. Die KI-Revolution: Produktivität trifft auf Deflation Strukturwandel mit Nebenwirkungen Künstliche Intelligenz ist längst keine Zukunftsvision mehr – sie wird bereits heute zur messbaren wirtschaftlichen Kraft. Studien und Notenbankanalysen zeigen übereinstimmend: Durch Automatisierung sinken Lohnstückkosten nachhaltig, was den Dienstleistungssektor dämpft und die Inflation tendenziell unter die Zwei-Prozent-Marke drückt. Diese disinflationäre Wirkung ist strukturell, nicht zyklisch. Was einerseits Zentralbanken Spielraum für lockerere Geldpolitik gibt, birgt andererseits gesellschaftliche Risiken: Höhere strukturelle Arbeitslosigkeit und zunehmende Ungleichheit in der Einkommensverteilung könnten politische Gegenreaktionen provozieren – von Umverteilungsforderungen bis zu höheren Staatsausgaben. Globales Wachstum: Robust, aber fragil Für 2025 und 2026 rechnen Ökonomen mit moderatem Wachstum, das von anhaltenden Risiken begleitet wird. Handelsspannungen und der Technologiewandel dominieren die Unsicherheiten. Die USA bleiben wirtschaftlich robust und profitieren als KI-Vorreiter von ihrer technologischen Führungsposition. Europa und weite Teile der Schwellenländer hingegen sind anfälliger für außenwirtschaftliche Schocks – sei es durch protektionistische Tendenzen oder volatile Währungen. Zinsen und Anleihen: Die neue Normalität USA: Vorsichtige Lockerung ohne Euphorie Die US-Notenbank hat am 10. Dezember 2025 den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der Zielkorridor für den Federal Funds Rate liegt nun bei 3,50–3,75 Prozent. Damit befindet sich die Fed in einem behutsamen Zinssenkungszyklus, doch die Märkte erwarten nur noch flache weitere Lockerung. Das bedeutet: Die Ära extrem niedriger Zinsen kehrt nicht zurück. Vielmehr etabliert sich eine neue Normalität moderat positiver Realzinsen. Politischer Druck und Fed-Nachfolge 2026 Jerome Powells Mandat als Fed-Chair endet im Mai 2026. Präsident Trump drängt öffentlich auf stärkere Zinssenkungen und wird den Nachfolger nominieren. Kandidaten wie Kevin Warsh oder Kevin Hassett gelten als Trump-nah, was Befürchtungen weckt: Ein gefügigerer Fed-Chef könnte die geldpolitische Unabhängigkeit schwächen und zu vorschnellen Lockerungen neigen – mit Risiken für Inflation und Vermögensblasen. Powell widersteht bisher dem Druck, doch 2026 werden die Fed-Meetings turbulent. Für Anleger bedeutet das: erhöhte Unsicherheit über die mittelfristige Zinspolitik. Europa: Zwischen Schwäche und Chancen In der Eurozone verfolgt die EZB einen abwartend-lockeren Kurs. Der nächste offizielle Zinsentscheid ist für den 18. Dezember 2025 angesetzt. Aus EZB-Reden und Marktkommentaren lässt sich ein „wait and see“-Ansatz ablesen: Schwächeres Wachstum gibt theoretisch mehr Spielraum für Zinssenkungen, doch fiskalische Risiken – hohe Schuldenquoten, demografischer Druck – setzen Grenzen. Die EZB wird vorsichtig agieren müssen, um Inflation nicht aus den Augen zu verlieren, während sie gleichzeitig die Konjunktur stützen will. Mittlere Laufzeiten (etwa 5 bis 7 Jahre) erscheinen attraktiver als langlaufende Staatsanleihen, da die Zinsstrukturkurve zwar fallende Kurzfristzinsen signalisiert, aber hartnäckige Langfristzinsen. Schwellenländer: Rendite gegen Volatilität Lateinamerika, Teile Asiens und Afrika müssen tendenziell höhere Nominal- und Realzinsen aufrechterhalten, um Währungen zu stabilisieren und Kapital anzuziehen. Das macht ihre Anleihemärkte renditestark, aber auch volatil. Für risikobereite Anleger mit entsprechendem Horizont durchaus interessant – für konservative Portfolios eher eine Beimischung als Kernposition. Aktienmärkte: Bewertung schlägt Momentum USA: Teuer, aber nicht alternativlos Die Vereinigten Staaten profitieren kurzfristig von ihrer KI-Dynamik und hoher Unternehmensqualität. Doch die Bewertungen sind hoch – insbesondere bei den Megacaps, die den Markt dominiert haben. Das Konzentrationsrisiko ist real. Die unterschätzte Chance: Mid- und Small-Caps (mittelgroße und kleine börsennotierte Unternehmen) Abseits der überbewerteten Tech-Giganten bieten US-Mid- und Small-Caps eine interessante Alternative. Nach der Erholung 2025 (Small-Caps +39 Prozent seit Jahrestief) zeigen die Fundamentaldaten Potenzial: Das prognostizierte Gewinnwachstum liegt bei 15 Prozent für 2025 und über 30 Prozent für 2026 – deutlich über dem der Large-Caps. Die Bewertungen sind attraktiv: Die Aktien sind günstig im Einkauf (Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 bis 16 im Vergleich zu 22 beim S&P 500) – ein Abschlag von rund 40 Prozent. Historisch gesehen ist das ein Set-up, das langfristig zur Outperformance neigt. Mehrere strukturelle Faktoren sprechen für kleinere US-Unternehmen: Binnenmarkt-Fokus: Rund 80 Prozent der Umsätze von Mid- und Small-Caps werden in den USA generiert (versus 59 Prozent bei Large-Caps). Sie profitieren direkt von „America First“-Politiken – Zölle, Rückverlagerung von Chipproduktion ins Inland, Infrastrukturprogramme. Zinssenkungen: Die Fed-Lockerung senkt die Fremdkapitalkosten stärker bei kleineren Unternehmen, was Investitionen sowie Fusionen und Übernahmen ankurbelt. Deregulierung: Die angekündigte Trump-Politik mit Steuersenkungen (effektiver Steuersatz auf 12 Prozent) und weniger Bürokratiebelastung kommt kleineren Unternehmen überproportional zugute. Sektorale Verschiebung: Industrie, Value-Titel und Micro-Caps könnten Tech-Megacaps outperformen – eine breitere Markt-Rallye statt Konzentration. Für 2026 sind bei moderatem Wachstum und fallenden Zinsen Mid- und Small-Caps eine zyklische Investition mit attraktivem Chance-Risiko-Profil. Langfristige Kapitalmarkterwartungen zeigen höhere reale Renditen für diese Segmente als für überteuerte US-Large-Caps. Europa: Günstig, aber strukturschwach Europa bietet attraktivere Bewertungen (Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 12 bis 14 im Vergleich zu 22 in den USA), leidet aber unter schwachem Trendwachstum (circa 1 Prozent BIP-Wachstum), politischer Fragmentierung und den Nachwehen der Energiekrise. Banken und zyklische Sektoren dominieren die Indizes – was für Volatilität sorgt, aber auch Chancen birgt, falls sich die Konjunktur stabilisiert. Die unterschätzte Seite: NextGenEU und Mid-Caps Was in der negativen Gesamtbetrachtung oft untergeht: NextGenEU (der 800-Milliarden-Euro-Wiederaufbaufonds der EU nach Corona) pumpt bis 2026 Gelder in Infrastruktur, Digitalisierung und erneuerbare Energien. Davon profitieren direkt europäische Mid- und Small-Caps – Maschinenbauer, Spezialchemie, Regionalbanken. Der MDAX (Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen) legte seit Jahresbeginn bereits 15 Prozent zu. Regionale Hotspots zeigen Dynamik: Osteuropa (Polen, Tschechien) mit Value-Erholung, Skandinavien mit grüner Technologie, Irland mit Pharma und Tech. Sektoren wie Luxusgüter (LVMH), Pharma (Roche) und Value-Industrie performen besser als der Gesamtmarkt suggeriert. Energie: teurer, aber widerstandsfähiger Der freiwillige Ausstieg aus russischem Gas hat die Preise verdreifacht und die Industrie geschwächt – keine Frage. Doch LNG-Diversifikation und der Ausbau erneuerbarer Energien (59 Prozent des EU-Stroms) mildern die Abhängigkeit. Netto ist Europa teurer geworden, aber auch weniger erpressbar. Allerdings: Die Politik hat bestellt, die Rechnung zahlen Verbraucher, Mittelstand und energieintensive Industrie. Die Folgen sind messbar – Abwanderung von Produktion, explodierende Insolvenzen, schwindende Wettbewerbsfähigkeit. Widerstandsfähig mag Europa sein, aber zu welchem Preis für die reale Wirtschaft? Rüstung: Kurzfrist-Rally, langfristig problematisch Die Rüstungsausgaben liegen bei rund 2 Prozent des BIP und verdrängen produktivere Investitionen. Unternehmen wie Rheinmetall und Hensoldt boomen kurzfristig mit vollen Auftragsbüchern. Doch strukturell sind diese Geschäftsmodelle fragil: Kapitalintensiv mit schwachen Margen (Hensoldt: negativer Free Cashflow – die Firma ist blank wie eine Kirchenmaus und chillt im Dispo) Extrem abhängig von staatlichen Aufträgen Hohe Verschuldung Überhitzte Bewertungen nach der Rally Langfristig ist das kein skalierbares Modell. Politische Risiken sind hoch – sobald ein Waffenstillstand oder Friedensabkommen näher rückt, drohen heftige Korrekturen. Was für Spekulanten interessant sein mag, ist für langfristig orientierte Investoren kein attraktives Set-up. Soziales: Stabilität gegen Wachstum Rund 30 Prozent des BIP fließen in Sozialausgaben – das stabilisiert den gesellschaftlichen Frieden, belastet aber das Wachstum. Priorisierung wird unausweichlich sein. Fazit für Europa Europa ist günstig bewertet, nicht kollabiert. Mid-Caps profitieren besonders von NextGenEU-Impulsen. Rüstung: kurzfristige Rally, langfristig problematisch durch Cashflow-Schwäche und politische Abhängigkeit. Fokus sollte auf Infrastruktur, Value-Industrie und selektiven Qualitätstiteln liegen. Asien: Diversität statt Pauschalurteil Bevor man in regionale Details geht, lohnt die Erinnerung an die schiere Dimension: Asien beherbergt rund 60 Prozent der Weltbevölkerung (circa 4,8 Milliarden von 8,1 Milliarden Menschen) und erwirtschaftet inflationsbereinigt etwa 45 bis 50 Prozent des globalen BIP. China trägt 18 bis 20 Prozent bei, Indien rund 8 Prozent, ASEAN (Staatenbund Südostasiens: Vietnam, Thailand, Indonesien, Singapur und weitere) 6 bis 7 Prozent. Dieser Anteil wächst durch fortschreitende Industrialisierung und den Technologie-Boom. Wer Asien als einheitlichen Block betrachtet, übersieht fundamentale Unterschiede zwischen den Teilregionen. China, ASEAN und Indien folgen verschiedenen Entwicklungsmodellen mit jeweils eigenen Chancen und Risiken. China: Der unterschätzte Innovationsmotor Das gängige Narrativ von Chinas strukturellen Problemen (Immobilienkrise, Demografie) greift zu kurz. Während diese Risiken real sind, vollzieht sich parallel eine technologische Transformation, die in ihrer Geschwindigkeit beispiellos ist. China dominiert die globale Patentlandschaft mit fast der Hälfte aller weltweiten Anmeldungen (circa 49 Prozent im Jahr 2024, über 1,8 Millionen Anträge), insbesondere in KI, Robotik und Quantentechnologie. Bei erneuerbaren Energien liegt das Land mit über 1.200 Gigawatt installierter Wind- und Solarkapazität an der Weltspitze – die Ziele für 2030 wurden vorzeitig erreicht, 59 Prozent der installierten Stromleistung stammen aus Erneuerbaren, CO₂-Emissionen im Energiesektor sinken messbar. Der Elektrofahrzeugmarkt zeigt die Dominanz besonders deutlich: China hält 76 Prozent des globalen E-Auto-Markts (12 bis 14 Millionen Verkäufe 2024) und beherrscht Batterie sowie Ladeinfrastruktur. Hier kommt die nächste Stufe der Automatisierung zum Tragen: sogenannte „Dunkelfabriken“ (dark factories) vollautomatisierte Anlagen ohne Beleuchtung oder menschliche Arbeiter, betrieben von KI, Robotern und Sensoren. Pioniere wie Foxconn, BYD, Xiaomi und Geely in Shenzhen und Xi'an steigern die Produktivität um das Zwei- bis Dreifache bei 15 bis 20 Prozent weniger Energieverbrauch. Chinas größter struktureller Vorteil: massive, günstige Elektrizität durch Überkapazitäten (erneuerbar plus Kernkraft), die Automatisierung und Hightech-Skalierung antreiben. Das Land führt weltweit bei Roboterdichte (über 50 Prozent der globalen Installationen), Hochgeschwindigkeitszügen, 5G-Netzen, Drohnen und Solarpaneelen. Für Anleger bedeutet das: Niedrige Bewertungen treffen auf hohe Innovationsdynamik – bei erheblicher politischer Unsicherheit. China ist kein „Value-Trap“, sondern eine Wette auf technologische Transformation gegen regulatorische Risiken. ASEAN: Die unterschätzte Alternative mit Brain Circulation ASEAN gilt als eine der dynamischsten aufstrebenden Regionen weltweit – und das aus gutem Grund. Das ASEAN-BIP wächst 2025/26 um 4,5 bis 5 Prozent, getrieben von ausländischen Direktinvestitionen in Vietnam (+15 Prozent), Indonesien und den Philippinen. Ein zentraler, oft übersehener Treiber: der Rückfluss hochqualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung kehren immer mehr Menschen zurück, die jahrelang in den USA, Europa oder Australien gelebt und gearbeitet haben – mit Kapital, Praxiserfahrung, Studienabschlüssen und internationalem Know-how. Diese „Brain Circulation“ bringt nicht nur Expertise in Tech, Digitalisierung und Management, sondern auch Investitionen und Netzwerke zurück in die Heimat. In Vietnam steigen Rückkehrer-Startups rasant, Indonesien nutzt sie für den Aufbau einer Digitalökonomie. Prognosen sehen bis 2030 einen zusätzlichen BIP-Wachstumsschub von 2 bis 3 Prozent durch diesen Talentpool. Die Region punktet mit mehreren strukturellen Vorteilen: Demografie: Junge, zunehmend gebildete Bevölkerung (Medianalter 30 Jahre) plus Rückkehrer-Know-how ergeben einen echten Innovationsmotor Diversifikation: Bewusster Weg aus der China-Abhängigkeit, Aufbau eigener Supply-Chain-Hubs (Elektrofahrzeuge, Halbleiter, erneuerbare Energien) Investitionsklima: steigende ausländische Direktinvestitionen, verbesserte Infrastruktur Für Anleger bedeutet das: ASEAN ist kein reiner „China-Alternative“-Trade mehr, sondern entwickelt eigene Wachstumsdynamik. Währungs- sowie Korruptions- und Verwaltungsrisiken bleiben, aber die Kombination aus jungen Demografien, Technologietransfer durch Rückkehrer und strategischer Neupositionierung macht die Region zu einem der attraktivsten Emerging-Market-Plays für 2026 und darüber hinaus. Indien: Der schlafende Riese erwacht Indien – mit 1,4 Milliarden Menschen die bevölkerungsreichste Nation der Welt – verdient besondere Beachtung. Der Aktienmarkt (Sensex/Nifty) legte seit 2020 über 200 Prozent zu, befindet sich aber seit Sommer 2025 in einer Verschnaufpause. Die Bewertungen sind mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 22 bis 25 höher als in ASEAN (14) oder China (10) – aber durch starke Fundamentaldaten gerechtfertigt. Was Indien besonders macht: ein BIP-Wachstum von 6,5 bis 7 Prozent (weltweit führend), eine sehr junge Bevölkerung (Medianalter 28 Jahre), rasante Digitalisierung (Fintechs, Online-Handel) und massiv steigende ausländische Investitionen. Die indische Zentralbank hat 2025 erstmals seit Jahren die Zinsen gesenkt, was Konsum und Investitionen ankurbelt. Für 2026 erwarten Analysten 10 bis 15 Prozent Indexanstieg, getrieben von zweistelligem Gewinnwachstum in IT, Banken und Konsum. Risiken: Die hohen Bewertungen machen den Markt anfällig für Korrekturen, die Rupie könnte durch mögliche US-Zölle unter Druck geraten. Langfristig aber ist Indien eine der überzeugendsten Wachstumsgeschichten weltweit – besonders in Value-Sektoren wie Banken und Infrastruktur. Lateinamerika: Demografie trifft auf Rohstoff-Hebel Etwa 8 bis 9 Prozent der Weltbevölkerung leben in Lateinamerika und der Karibik – verteilt auf 33 Länder, aber mit einem entscheidenden Vorteil: Rund 90 Prozent der Bevölkerung sprechen eine von zwei Sprachen (Spanisch oder Portugiesisch). Das macht die Region für Unternehmen deutlich attraktiver als das sprachlich zersplitterte Europa. Hinzu kommen überwiegend junge, urbane Gesellschaften mit einem Medianalter von 31 bis 32 Jahren – ein wichtiges Potenzial, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Struktur und traditionelle Stärken Die Region bleibt rohstoffreich (Energie, Metalle, Agrar) und profitiert von der Neuordnung globaler Lieferketten. Die Abkehr von reiner China-Abhängigkeit und die Produktionsverlagerung nach Mexiko und Lateinamerika kurbeln standortnahe Industrie, Logistik und Dienstleistungen an. Mexiko ist hier der klare Gewinner. Chancen jenseits der Rohstoffe Was die Region interessant macht, geht über traditionelle Rohstoff-Investments hinaus: Grüne Industrien: Ausbau erneuerbarer Energien (Wind, Solar, Wasserkraft) und Batteriewertschöpfung rund um Lithium in Chile, Argentinien und Bolivien. Die Energiewende benötigt lateinamerikanische Rohstoffe. Wachsende Mittelschichten: In Mexiko, Chile, Kolumbien und Brasilien stützen sie Konsum, Finanzsektor und Online-Handel. Der Binnenmarkt gewinnt an Bedeutung. Digitale Ökosysteme: Fintechs (digitale Finanzdienstleister) und Plattformen erschließen in Brasilien, Mexiko und Kolumbien bisher unterversorgte Märkte (Banking, Zahlungssysteme, Versicherungen). Die digitale Durchdringung ist niedrig – was Wachstumspotenzial bedeutet. Warum Lateinamerika ins Portfolio passt Lateinamerika bietet eine Mischung aus Rohstoff-Hebel, Binnenkonsum und Digitalisierung – mit höherem Risiko, aber auch höherer Renditeprämie. Diversifikation: andere Zyklen und Treiber als USA oder Europa. Rohstoffe, Demografie und Währungen reagieren oft gegenläufig zu entwickelten Märkten. Risiko-Prämie: Politische und fiskalische Unsicherheit ist der Preis für höhere erwartete Renditen. Wer breit gestreut (über ETFs oder Fonds) investiert, kann diese Prämie nutzen, ohne von einem Einzelstaat abhängig zu sein. Realistisches Fazit Junge Bevölkerung allein reicht nicht – ohne Bildung, Rechtsstaat und Investitionen produziert sie eher Arbeitslosigkeit und Instabilität. Aber in Kombination mit Rohstoffen, Nähe zu den USA, Digitalisierung und punktuellen Reformfortschritten macht sie Lateinamerika zu einem interessanten, wenn auch spekulativeren Baustein in einem global diversifizierten Portfolio. Frontier-Märkte: stark heterogen Frontier-Märkte (von englisch „frontier“ = Grenze) sind aufstrebende Volkswirtschaften zwischen Schwellenländern und den am wenigsten entwickelten Ländern – oft zu klein oder zu illiquide für den Emerging-Markets-Status (etwa MSCI-Index), aber mit Potenzial für schnelles Wachstum. Die Bandbreite ist enorm – pauschale Risikoeinschätzungen greifen zu kurz. Golfstaaten: Kapitalstark und strukturell im Wandel Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar gehören zu den Frontier-Märkten, sind aber fundamental anders positioniert als kleinere Volkswirtschaften. Sie bieten hochliquide, moderne Börseninfrastrukturen, stabile (oft an den USD gekoppelte) Währungen und massive Kapitalreserven. Ihre Volatilität stammt weniger aus struktureller Schwäche als aus Ölpreisschwankungen und geopolitischen Entwicklungen. Die Vision-2030-Programme zielen auf Diversifikation weg vom Öl – Investitionen in Tourismus, Technologie, erneuerbare Energien und Finanzdienstleistungen. Die Bewertungen sind attraktiv, die makroökonomischen Fundamentaldaten solide. Für Anleger, die regionale Diversifikation suchen, bieten diese Märkte strukturelle Transformation bei vergleichsweise geringem Liquiditäts- und Währungsrisiko. Kleinere Frontier-Märkte: Wachstum mit höherer Schwankungsbreite Nigeria, Kenia, Bangladesch, Vietnam, Kasachstan, Marokko und andere kleinere Frontier-Märkte zeigen andere Charakteristika: BIP-Wachstum oft 5 bis 8 Prozent pro Jahr, getrieben von junger Demografie (Medianalter circa 25 Jahre), Urbanisierung, Digitalisierung und ausländischen Direktinvestitionen. Kurs-Gewinn-Verhältnisse liegen bei 8 bis 12, mit Renditeprämien von 5 bis 10 Prozent über entwickelte Märkte. Allerdings sind diese Märkte anfälliger für politische Instabilität, Währungsschwankungen, begrenzte Liquidität und externe Schocks (Rohstoffpreise, Klimawandel, globale Krisen). Rechtssicherheit und Verwaltungseffizienz variieren stark. Für wen und wie? Für konservative Portfolios sind die kleineren Frontier-Märkte zu schwankungsintensiv. Die Golfstaaten hingegen können als Diversifikationsbaustein durchaus auch in ausgewogeneren Portfolios eine Rolle spielen. Für globale Diversifikation und höhere Renditeerwartungen ergänzen Frontier-Märkte Schwellenländer und entwickelte Märkte um die „nächste Wachstumswelle“. Entscheidend sind breite Streuung über Regionen und Sektoren sowie ein langer Anlagehorizont – besonders bei den kleineren, volatileren Märkten. Moderne Portfolio-Architektur macht den Unterschied Eine differenzierte Aufteilung der Schwellenländer – etwa Asien aufgesplittet in China, Japan, Indien plus dedizierte ASEAN- und Lateinamerika-Anteile – ändert die Depot-Strategie grundlegend. Frontier-Märkte können dann als gezielter Satellit hinzukommen (beispielsweise via spezialisierte Fonds), ohne die Überschneidungsrisiken breiter Schwellenländerfonds. Vorteile dieser Aufteilung: Gezielte Verteilung: Der Asien-Split erfasst regionale Unterschiede (China: Tech und Rohstoffe; ASEAN: Wachstum und Demografie; Indien: Konsum und Digital). Lateinamerika addiert Rohstoffe und Produktionsverlagerung – das reduziert Konzentration und Korrelation. Risikokontrolle: Kein „Ein Topf für alle“-Schwellenländerfonds mit China-Dominanz (oft 30 bis 40 Prozent), sondern 5 bis 10 Prozent pro Segment für ein besseres Risiko-Rendite-Profil. Kurz: Frontier-Märkte sind nichts für das Grundinvestment, aber als dosierter Bestandteil einer modern strukturierten, segmentierten Schwellenländer-Strategie überaus sinnvoll – für Anleger mit entsprechendem Zeithorizont und Risikobereitschaft. Plausibles Szenario 2026: Rotation statt Konzentration Für 2026 ist ein Schwenk zu breiteren Rallyes denkbar – weg von reiner US-Megacap-Dominanz, hin zu günstigeren Regionen. Voraussetzung: sinkende Zinsen und ein tendenziell schwächerer Dollar. Wer ausschließlich auf Momentum gesetzt hat, könnte überrascht werden. Regionen im Überblick: Charakteristika und Risiko-Rendite-Profile